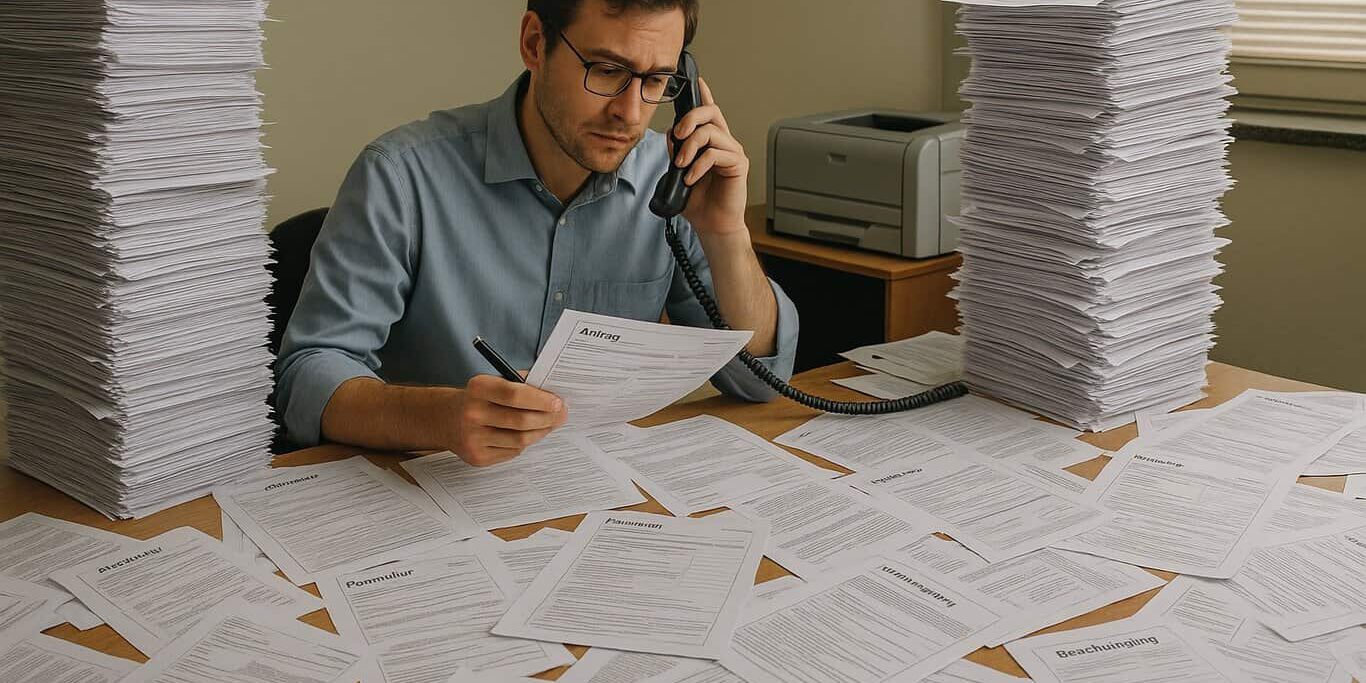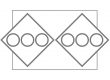Wir haben keine Angst vor der Zukunft, sondern vor der Vergangenheit.
Was passiert, wenn ein Facharbeiter aus dem Ausland in Deutschland arbeiten möchte? Es wird erst mal ein Wald abgeholzt, um darauf die erforderlichen Anträge und Formulare auszudrucken.
Das Ausland liebt uns für unsere umständlichen, langen, unaussprechlichen Ausdrücke wie „Umweltschutzförderungsprämienanbahnungsgesetz“. Ebenso lang, umständlich und unverständlich sind allerdings unsere Vorschriften, unsere Prozesse und Verwaltungsabläufe – wenn das Wort „Ablauf“ hier nicht falsche Assoziationen herausbeschwört („Da läuft ja nichts!“).
Man kann sagen: Die Deutschen lieben Vorschriften, sie lieben Prozesse. An die Grenze des Irrsinns deutlich wird das bei der Steuererklärung – die müsste eigentlich erklärt werden.
Seit die Deutschen die Druckerpresse, das Auto und den Computer erfunden haben, hat sich einiges getan. Deutschlands Innovationskraft schwindet seit geraumer Zeit, unken die Experten. In der Forschung seien wir zwar immer noch stark, aber in der Umsetzung – ei, ei, ei. Vor allem bei der Digitalisierung setzen wir immer noch auf die Dampfmaschine. Während andere Kulturen den Wandel umarmen und jede soziokulturelle Veränderung direkt in ihr Herz schließen, bleiben die Deutschen skeptisch und auf Abstand: Erst mal schauen. Wird dieser Hype um das Internet sich nicht doch noch als Eintagsfliege erweisen?
Was die Frage aufwirft: Warum sind die Deutschen eigentlich immer so ängstlich, wenn es darum geht, den Status quo zu verrücken? Die Antwort ist ganz einfach: Weil wir an der „German Angst“ leiden. Sabine Bode, Autorin von „Die deutsche Krankheit – German Angst“, bietet uns diese Definition unserer nationalen Malaise an: „Unter German Angst verstehen wir eine Mischung aus Mutlosigkeit und Zögerlichkeit, gepaart mit Zukunftsängsten und einem extremen Sicherheitsbedürfnis.“
Hamlet war offenbar ein Deutscher
So einfach die Antwort aufs Schlagwort gebracht ist, so schwer ist sie in ihrem Wesen zu akzeptieren. Darum muss die Argumentation jetzt etwas komplexer werden, und dafür entschuldige ich mich schon einmal vorab. Aber wer die Wurzeln des deutschen Dauerzauderns finden will, muss im Geschichtsbuch ein ganzes Jahrhundert zurückblättern. Zurück bis zu dem Zeitpunkt, da der 20-jährige Ernst Jünger in einem Schützengraben des Ersten Weltkriegs an der Westfront in sein Tagebuch notiert:
„Ein Grab, in dem 6 deutsche Krieger ruhen, war durch eine schwere Granate aufgewühlt, aus dem Trichter sahen drei Paar Stiefel heraus, in denen Zeugfetzen und gebleichte Beine steckten. Ein seltsamer Anblick. Nicht einmal die Toten haben ihre Ruhe, sie werden wieder an die Oberwelt gezerrt, ihre Beine von Splittern gebrochen und ihre Knochen von Kugeln durchlöchert.“
Das ist keine makabre ChatGPT-Erfindung, sondern ein authentischer Text. Der Erste Weltkrieg war die Hölle. Ein Kulturbruch ohne Beispiel. Die apokalyptischen Szenarien, die sich damals boten, waren so fürchterlich, dass viele der jungen Soldaten gar nicht mehr aufhören konnten zu zittern. Ihr Nervensystem war buchstäblich explodiert (das Phänomen wurde bekannt als „Shell Shock“).
Im Ersten Weltkrieg lernten die Menschen die andere, die dämonische Seite der Technik kennen, und sie lernten sie fürchten – aber warum hallt dieser Schock vor allem in uns Deutschen immer noch nach?
Vom Bürgerbräukeller in die Reichskanzlei
Vermutlich, weil die Folgen des Ersten Weltkriegs für die Deutschen rundum traumatisch waren. Krieg verloren, Kaiser verloren, Armee weg, die Pickelhaube stark genickt, das alles noch weiter verdüstert von Reparationszahlungen an die Siegermächte in astronomischer Höhe, von Inflation und Massenarbeitslosigkeit. Dieses Bombardement von Krisen erzeugte immensen psychischen Druck. Der US-amerikanische Autor Thomas Wolfe, damals Zeitzeuge der deutschen Zwischenkriegszeit, erlebte mit eigenen Augen, wie die „ganze Nation von der Seuche einer ständigen Furcht infiziert war“. Auf dem Rücken dieser Bestie „German Angst“ gelangte schließlich Adolf Hitler an die Macht.
Welche Gewalt die Angst über die deutsche Seele hatte, spürte auch der italienische Schriftsteller und Journalist Curzio Malaparte: „Wenn der Deutsche beginnt, Angst zu haben, wenn sich ihm die geheimnisvolle deutsche Angst ins Gebein schleicht, dann erst erregt er Schrecken und Mitgefühl … Und gerade dann wird der Deutsche gefährlich.“
Die Welt zu Gast bei der German Angst
Prophetische Worte, die sich aufs Schrecklichste bewahrheiten sollten. Die nächsten Stationen auf dem Zeitstrahl – Zweiter Weltkrieg, erneute Niederlage im militärischen Ringen, Schuld und Scham wegen des Holocausts und der übrigen Kriegsverbrechen, Teilung des Landes, Besatzungsmächte, Wiederaufbau, Kalter Krieg – ließen der deutschen Seele keine Atempause. Die Angst blieb und setzte sich fest. Sie wurde zu einem festen Bestandteil unseres kollektiven Lebensgefühls.
Sicher, diese Dinge sind, nach unserem individuellen Zeitgefühl, lange, lange her. Wir sind in der Zwischenzeit Fußballweltmeister geworden und Exportweltmeister, wir haben das Wirtschaftswunder erfunden und den Kaffeefilter. Doch auch Gefühle und Ängste werden durch die Generationen weitergegeben. Dafür findet man überall Anzeichen: Als 2006 die Welt mit ihren Nationalmannschaftgen zu Gast bei uns war, waren wir ja auch selbst erstaunt, wie nett und normal und undeutsch wir sein können.
Für einen Augenblick hatte sich in der globalen Fußballeuphorie der Teppich aus Furcht gehoben, der auf unserer Nationalseele liegt, und die Welt sah, dass dieses Land aus mehr Farben besteht als aus Schwarz, Rot und Gold.
Autoren: Johannes Rein & Robert Mattheiß